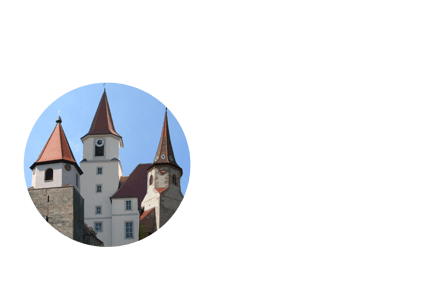St. Jakobus-Kirche Ehingen
Baugeschichte

Die Ehinger Pfarrkirche St. Jakob steht - wie es für alemannisch/fränkische Kirchengründungen im frühen Mittelalter typisch ist - auf einer Erhöhung über einem Bach, dem Mühlbach. An dessen Ufer liegt unterhalb der Kirche der zugehörige alte Herrenhof, der heute noch sogenannte Meierhof (Mooarhof).
Ein zweiter Hof lag auf dem jenseitigen Ufer, unterhalb des Gasthauses "Zum Löwen", in dessen Bereich Grabbeigaben (Keramik) eines alemannisch-fränkischen Friedhofes zu Tage kamen, die auf die Entstehung Ehingens im 6./7. Jahrhundert hinweisen.
Auch die Gründung der ersten Pfarrkirche - wohl eine Fachwerkkirche - darf in diese Zeit gesetzt werden. Ein dritter Hof bestand bei der Ottilienkapelle.
Ehingen ist im frühen Mittelalter also aus drei alten, am Mühlbach gelegenen Höfen entstanden. Die Überlieferung besagt, dass Bischof Otto von Eichstätt (1182 - 1196) in Ehingen eine Kirche geweiht hat. Es ist zu vermuten, dass die große Hofgemarkung Ehingen bei ihrer Gründung zu dem großen Forstbereich gehörte, von dem Heinrich III. 1053 einen Teil dem Bischof von Eichstätt schenkte, so dass Ehingen wohl ein alter Königshof war.
1524 Auf der Südseite der Kirche baute man eine Kapelle an, die später nach außen geöffnet wurde. Sie dient nunmehr als überwölbte Eingangshalle ("Käppele" genannt) und hat gotische Kreuzrippen, die köpferlos in den Ecken auslaufen in der Vierung mit Schlussstein.
1528 Einführung der Reformation durch den Landesherrn und erste Visitation durch die Superattendenten Althammer und Rurer.
1648 Das Kirchengebäude musste viele Turbulenzen und Kriege erleiden. Am Samstag vor Lätare, am 29. März, kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges bedeutete das sogar das Ende des ursprünglichen Baus. Durchziehende französische und schwedische Truppen zündeten das Gebäude an und legten es in Schutt und Asche. Sogar die Glocken stürzten herab und schmolzen. Wie der Kirche ging es vielen Gebäuden in Ehingen.
1662 Einweihung nach Wiederaufbau der zerstörten Kirche. Das Bauholz lieferten auch die umliegenden Gemeinden.
1699 Der beschädigte Turm wurde einer Reparatur unterzogen.
1701 Im August beschädigte ein Blitzschlag den Turm so stark, dass eine erneute Instandsetzung unumgänglich wurde.
1713 Ein erneuter Blitzeinschlag setzte den Turm in Brand. Nur durch den beherzten Einsatz von Leonhard Gattermayer, der in das obere Stockwerk stieg und den "Brand" herunterwarf, konnte das völlige Abbrennen der Kirche verhindert werden.
1765 Ein Orkan erschütterte den Kirchturm, so dass der komplette Turm abgetragen werden musste. 1767 begann unter Johann David Steingruber die Generalsanierung. Dabei wurde der bisherige Sakristeianbau entfernt. Nach der Verlegung der Sakristei in das Untergeschoss gab es eine zweite Sakristei im Obergeschoss des Turmes. Kanzel und Orgel wurden von den ursprünglichen Plätzen entfernt. Die von Schreinermeister Doberer 1699 gefertigte Kanzel wurde in den heutigen Kanzelaltar eingefügt; darüber installierte man die Orgel. Der Altar hat einen flachen Aufbau, beiderseits des Kanzelkorbes gemalte, gedrehte Säulen. Im Kanzelkorb in Muschelnischen befinden sich Figuren. In der Mitte Christus, davon links und rechts je zwei Evangelisten. Der Schalldeckel ist bekränzt mit Engelsköpfen, Ziergiebel und Kreuz.
1773 Vor einigen Jahren wurde eine ursprünglich versilberte Totenkrone von 1773 wiederentdeckt. Sie hat einen würdigen Platz in der Kirche erhalten. Die Krone wurde ledigen Verstorbenen auf den Sarg gebunden.
1827 Bei Renovierungsarbeiten wurde die Wand, an der die Kanzel und der Altar angebracht waren, um vier Fuß nach vorne ins Langhaus versetzt. Damit wurde ein Raum hinter dem Altar gewonnen und gleichzeitig der Orgelstand vergrößert.
1847 Ein schweres Hagelgewitter zerstörte 88 Glastafeln an den Kirchenfenstern und 28 Scheiben an den Turmfenstern.
1897 unterzog man das Kircheninnere einer umfassenden Erneuerung und Verschönerung. Das Männergestühl wurde erneuert und die Frauen- und Kinderstühle wurden neu gestrichen. Pfarrer Georg Bickel aus Mönchsroth wurde beauftragt, ein neues Altarbild mit der Abendmahlsszene zu malen.
1949 Der Taufstein aus dem Jahr 1699, gefertigt von Schreiner und Schulmeister Abraham Doberer, wurde in Nürnberg vom Kirchenmaler Franz Wiedl gründlich renoviert. Der von Bildhauer Fischer geschnitzte, kronenförmige Aufsatz erhielt vergoldete Verzierungen.
2012 - 2015 Grundlegende Erneuerung und Renovierung erfuhr die Kirche auch im Inneren. Der Altarraum wurde neu gestaltet und den Erfordernissen angepasst. Wichtig war Pfarrer Walter Huber und dem Kirchenvorstand, dass der ursprüngliche Charakter der Kirche erhalten blieb, der Raum jedoch zeitgemäßer genutzt werden kann. Der neue Altar, der in der Lichtachse der beiden Seitenfenster steht und aus heimischem Muschelkalk gebaut ist, soll in seiner schlichten, aber massiven Form zeigen, wozu er dient: Der Sammlung der Gemeinde, zum Mahl der Versöhnung und der Gemeinschaft.
Die rote Kerbe im Kreuz, das sich durch den Altarblock schiebt, steht für die Liebe Gottes, die bis an den Rand des Vorstellbarem geht und darüber hinaus tief in uns einsenkt. Die Bodenplatte und der Stein unter der Kanzel sind aus demselben Material wie der Altar. Dadurch soll aufgezeigt werden, dass der neue Altar eigentlich zur Kanzel-Altar-Wand gehört.
Informationen zum Inneren der Kirche

An den Seitenwänden der Eingangshalle befinden sich die Grabtafeln von Pfarrer Christian Tobias Possin und seiner Gattin, der von 1750 - 1777 als Pfarrer in Ehingen wirkte. Er verstarb 1782 in Ehingen.
Die 31 Bilder in den Kassetten der Empore wurden 1948 bei Renovierungsarbeiten freigelegt. Wer die Porträts der Apostel und die biblischen Szenen gemalt hat, ist nicht bekannt. Jedoch müssen zwei Maler daran gearbeitet haben, denn die Farbgebung und die Darstellung der Gewänder unterscheiden sich erheblich von denen der Apostel. Sicher ist, dass Pfarrer Jodukus Kepner das Jesusportrait gemalt hat.
Eine derbe, stattliche Figur mit wallendem Haar, in der Hand den Wanderstab und den Blick beinahe träumerisch in weite Ferne gerichtet.
So wurde 1699 der Jakobus gemalt. "Sponsoring" gab es auch damals schon, denn diesen Jakobus "... hat mahlen lassen 1699.", lautet die Inschrift.
Auf den Kassetten der Empore sind abgebildet: Die Apostel Matthias, Matthäus, Bartholomäus, Johannes, Andreas, Judas, Thaddäus, Simon, Phillippus, Thomas, Jakobus der Ältere, Petrus und Jakobus der Jüngere mit ihren entsprechenden Attributen.
Simon mit der Säge, weil er lebendigen Leibes zersägt worden sein soll; Andreas mit dem schrägen gleichschenkligen "Andreaskreuz", an dem er den Märtyrertod erlitten hat; Petrus im Blick auf Matth. 16,19 mit zwei Kirchenschlüsseln; Johannes mit dem Kelch, über dem die Schlange züngelt, jedoch durch den Segen des Apostels entgiftet und gebannt.
Die Ober- und Untergewänder sind in leuchtenden Farben gehalten, wobei grün und blau, rot und weiß, hellgrau und beige miteinander abwechseln.
Einander gegenüber befinden sich Johannes der Täufer, der eine Taufschale ausgießt und in der anderen Hand einen Kreuzesstab hält, um den sich ein Band schlingt, mit der lateinischen Inschrift Ecce agnus Dei (Siehe, das ist Gottes Lamm), und König David im purpurnen Königsmantel, auf der Harfe in Andacht das Lob Gottes spielend.
Je 13 Bilder zieren die Nord- und Südseite, 5 schmücken die Westseite der Emporen. Die Jahreszahlen weisen auf eine Entstehung der Gemälde in den Jahren 1663 bis 1669 und ergänzend im Jahr 1699 hin.
Quelle: https://www.hesselberger-kirchen.de/Kirchen-der-Region/Ehingen/St-Walburgis-und-Nikolaus.html
Impressionen zu St. Jakobus
Kapelle St. Ottilien und Wendelin in Ehingen

Die Ehinger Kappel
Die Kappel (=Kapelle) St. Ottilien und Wendelin war wohl einst die "untere Kirche" oder wie manche auch vermuten die Kirche von "Ehingen am Sand" (im Gegensatz zu Ehingen am Berg). Das
Kirchenschiff stammt vermutlich aus dem 11. bis 12. Jahrhundert. Umformung im späten 15. Jahrhundert.
Der Chorraum stammt aus dem späten 15. Jahrhundert.
Bauherr dieser Kirche war vermutlich der letzte Abt von Auhausen Gg Truchseß v. Westhausen. Im Kreuzgewölbe des Chorraums finden sich die Geschlechterwappen der Hohenzollern und der Edlen v Tann
a.d. Altmühl, das 3. Wappen ist unkenntlich.
Die Kappel lag einst am alten Pilgerweg zum Marienheiligtum Königshofen an der Heide.
Der Taufstein (gestiftet von Hans und Barbara Ullmann) befand sich ursprünglich in der Jakobuskirche. 1648 wurde diese durch ein Feuer größtenteils zerstört. Zur Einweihung der neuen Kirche
am 12.1.1661 wurde dieser Taufstein gestiftet. Die erste Taufe war dann am 23.1.1662.
1699 schon nahm man diesen Taufstein in die Kappel, weil im Zuge der Turmreparatur ein neuer Taufstein geschaffen wurde.
Interessant dürfte noch sein, dass die Kanzel aus der Kappel nach Aufkirchen verkauft wurde, wo sie noch heute ihren Zweck erfüllt.
Die Kappel wurde mehrere male renoviert und um- bzw. angebaut. Heute dient sie der Kirchengemeinde als Gemeindehaus und bietet den vielfältigen Gruppen und Veranstaltungen ganz unterschiedliche
Räume.
Das Kirchenschiff beheimatet heute den großen Saal der Kirchengemeinde. Die Flachdecke in Holzbauweise wurde in den 60er Jahren erneuert; Konstruktionslöcher der ursprünglichen Balkenlager sind
z.T. noch erkennbar: Im Zuge der letzten Umbaumaßnahmen wurde sie in aufwändiger Eigenarbeit zur schalldämpfenden Decke umkonstruiert.
Der ursprüngliche Zugang war von Norden her. Die Fenster wurden mehrfach verändert.
Als bewegendes Ereignis darf die Freilegung mittelalterlicher Fresken (hauptsächlich an der Westwand des Kirchenschiffes aber auch an der Südwand: Teile einer Christopherusfigur) bei der letzten
Umbaumaßnahme betrachtet werden.
Im unteren Bereich ist ein Fries aus Faltenwürfen (als Weiß dient die gebr. Weiße Kalktünche des Untergrunds) erkennbar. Der Fries setzt in der Höhe von 2,7 m an und erstreckt sich nach
unten.
Über dem Faltenwurf sieht man ein ca. 30 cm hohes Rankenfries: überwiegend rotes Ocker, vereinzelt grüne Palmwedel.
Der Biblische Zyklus zeigt 1. die Grablegung, 2. die Verkündigungs- u. Heimsuchungsszene, 3. die Geburt Jesu (ganz deutlich ist die liegende Maria erkennbar) und 4. die Anbetung der Könige.